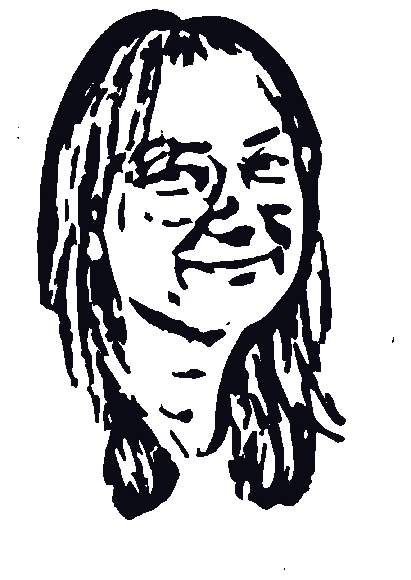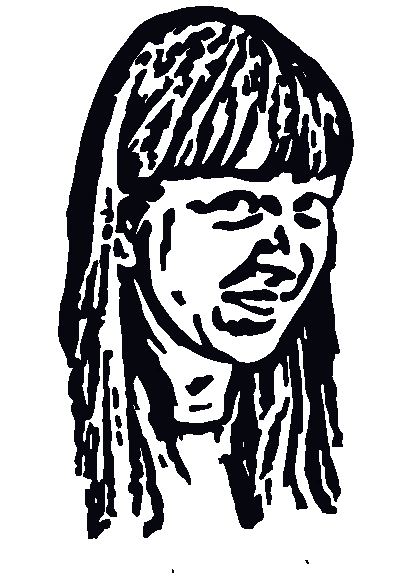Manchmal möchte ich meinen Computer aus dem
Fenster werfen. Aus einem der vielen offenen Tabs ertönt
Musik, aus einem anderen erklingt das ding einer
neuen E-Mail (oder war es eine WhatsApp-Nachricht?),
Recherchetabs sind offen, von denen ich
abgedriftet bin, um mich viel interessanteren Dingen
zu widmen als meiner To-do-Liste. Mein Handy neben
mir macht Geräusche und ich muss nachsehen –
wer, was, wie, wo. Die Aufgaben, die ich zu erledigen
habe, erstrecken sich ins Unendliche und ein Gefühl
der Überforderung stellt sich ein. Aber seien wir doch
mal ehrlich – es wäre alles zu schaffen, würde ich mich
nur darauf konzentrieren.
Mittlerweile ist es fast als Kunst zu bezeichnen, ununterbrochen
an einer Aufgabe zu arbeiten und sich so
sehr zu vertiefen, dass man dabei den sogenannten
Flowzustand erreicht. Denn jedes Geräusch, jedes Gespräch,
jede schnelle Nachricht wird dankend in
Empfang genommen, um sich von den To-dos ablenken
zu lassen. Mal wird schnell eine 20-minütige
Serienfolge oder Scrollen auf den Social Media-Apps
als Pause dazwischengeschoben – was soll da auch
schon groß passieren?
Tatsächlich passiert da eine ganze Menge, denn nach
jeder Unterbrechung brauchen wir im Schnitt 23 Minuten
und 15 Sekunden, um unsere Aufmerksamkeit
zurückzuerlangen und wieder konzentriert an der eigentlichen
Aufgabe zu arbeiten. Dies erklärte Gloria
Mark, Professorin für Informatik an der University of
California, Irvine, in einem Interview. Wie fühlen sich
die Dauertexter jetzt?
Screens, Screens, Screens – überall – in allen Formen
und Größen und in allen Lebensbereichen. Ohne das
Internet geht heutzutage nichts mehr. Sei es im Arbeitskontext,
wo viele Berufe verlangen, dass wir in den
Computer starren. Oder im universitären Kontext,
denn Studieren ohne Computer oder Tablet ist nicht
mehr möglich. Nicht zu vergessen im privaten Rahmen,
wo wir zum Entspannen Netflix anmachen und
wenn wir es ins Bett geschafft haben, noch ein bisschen
Doomscrolling mit dem Smartphone betreiben.
Ganz klar, wir sind alle abhängig.
Und wer kann es uns verdenken? Die Gesellschaft ist
strukturell darauf ausgelegt, online zu sein – ob nun in
den Arbeitssektoren oder privat. Vor allem auf den sozialen
Medien tummeln sich bunte Bilder,
Freund*innen vernetzen sich, es wird gelacht, geteilt,
geschaut und partizipiert. Jeder Like, den man bekommt,
verursacht einen Rausch von Bestätigung und
dem Verlangen nach mehr. Dopamin durchflutet unsere
Hirne und das wollen wir natürlich so oft
wiederholen wie nur möglich. Also behalten wir unser
Verhalten bei, verweilen in den Apps und konsumieren,
was das Zeug hält – vor allem Werbung (hmm, als
hätte sich jemand etwas dabei gedacht).
Justin Rosenstein, Erfinder des Like-Buttons von
Facebook, verglich beispielsweise Snapchat schon
2017 mit Heroin. Er hat Konsequenzen aus seinem
Verhalten gezogen und sich strikte Regeln bei seiner
Smartphone-, Internet- und Social Media-Nutzung
gesetzt.
Ich selbst merke die Auswirkungen der Bildschirme
und ihrer Inhalte sowohl physisch als auch psychisch.
In stressigen Zeiten, wenn ich lange vor dem PC sitzen
muss und vor mich hin tippe, merke ich manchmal,
wie mir eine Gehirnzelle nach der anderen abstirbt.
Die Augen brennen, mein Kopf ist leer und fühlt sich
gleichzeitig voll an, wie benebelt. Im Hier und Jetzt
gibt es unendlich viele
Möglichkeiten sich aus
der realen Welt herauszukatapultieren. Legt
man es darauf an, muss
man keine Sekunde unbeschallt leben. Reiz-überflutung
als Ablenkung. Die Konsequenzen sind uns allen
bekannt: zum Beispiel eine schlechte Körperhaltung,
unruhiger oder wenig Schlaf, eine kurze Aufmerksamkeitsspanne,
Irritation, bis hin zur Begünstigung von
Angststörungen und Depressionen. Das Leben fühlt
sich schnell zu viel an, obwohl kaum etwas passiert.
Lord have mercy, today drained me.
„Im Grunde treiben wir uns alle gegenseitig in diese Abhängigkeit. Von wegen HDGDL.“
Der Beginn der Internetabhängigkeit
Manchmal frage ich mich, wie es dazu kam. Schauen
wir uns mal meinen kurzen exemplarischen Verlauf der
Internetnutzung von der Kindheit bis heute an, wohl
wissentlich, dass ich (weiß, weiblich, Millennial) stellvertretend
nur für einen kleinen Teil der Gesellschaft
stehen kann.
Nostalgisch erinnere ich mich zurück an dieses bestimmte
Rauschen und Knarren, das ertönte, als wir –
meine Familie und ich – uns in den späten 90ern zum
ersten Mal mit dem Computer in das Internet einwählten
und plötzlich keiner mehr telefonieren
konnte. Der Computer stand fest in einem von der Familie
dazu auserkorenen Büro, mit Röhrenbildschirm
und klackernder Tastatur. Eine neue Welt – wir waren
online, ohne Google, aber mit ominösen Internetseiten.
Ich kann mich zu Beginn der neuen Ära kaum an eine
eigene zielgerichtete Computernutzung entsinnen,
mit großer Wahrscheinlichkeit, weil es keine gab. Dunkel
kommen Bilder und Melodien von
Computerspielen in den Sinn, aber dann wohl doch
nicht so prägend, wie gedacht. [Jegliche aus Neugier
betriebene Internetrecherche zu expliziten Inhalten als
Teenager wird hier ausgeklammert.] Interessant wurde
es, als ich YouTube entdeckte und dort Stunden um
Stunden verbringen konnte. Über ICQ und schülerVZ
gelangte ich zum globalen Facebook. So schlich
sich die Dopaminmaschine Internet Schritt für Schritt
in mein Leben ein. Als das Internet mit Laptops, Tablets
und Smartphones mobil wurde, war es dann mit
der Unabhängigkeit ganz vorbei. Mittlerweile tummeln
sich auf Facebook hauptsächlich Boomer und
Gen X, während der Rest zu Instagram, TikTok und
Co. migriert ist.
Mit 12 Jahren bekam ich mein
erstes Handy, ein unkaputtbares
Nokia, dessen bestes Feature
„Snake“ war! WLAN gab es noch nicht und als ich ein
neues Handy bekam, welches den gefährlichen Internetbutton
besaß, wurde ich jedes Mal mit einem
Adrenalinstoß durchfahren, wenn ich versehentlich
draufdrückte. So wurde ich ständig von der Angst begleitet,
die Familie unabsichtlich in finanziellen Ruin
zu treiben. Guthaben musste aufgeladen werden und
jede SMS kostete Geld, weshalbmandieLeerzeichenweglassen mussteum Platzzusparen.
Freund*innen, die
einen Handyvertrag hatten, waren meinen Eltern suspekt.
Well, well, well, how the turntables … Kommt
heute jemand mit einer Prepaidkarte um die Ecke, ziehen
wir verwundert die Augenbrauen hoch. Wir
erwarten voneinander ständige Verfügbarkeit. Alles,
was aus der Reihe fällt, wird als störend, unnötig und
kompliziert abgestempelt. Im Grunde treiben wir uns
alle gegenseitig in diese Abhängigkeit. Von wegen
HDGDL.
Das Smartphone und wir
Abhängigkeiten zu entkommen ist enorm schwer. Ich würde behaupten, dass es am produktivsten ist in Sachen Internet und Co. die suchtbegünstigenden Objekte ganz aus dem Leben zu streichen und keinen Zugriff mehr zu haben. So in etwa habe ich das auch gemacht und das bereits mehrmals. Das letzte Mal war vor ungefähr zwei Jahren – da habe ich WhatsApp gelöscht, war auf keiner Social Media-Plattform vertreten und nur telefonisch erreichbar (und per E-Mail natürlich). Auslöser war die Vermischung von Privatem und Beruflichem auf WhatsApp, die mich ständig mein Handy checken ließ, gestresst von der Frage, ob irgendwo irgendjemand etwas von mir brauchte. Die Prokrastination durch die sozialen Medien brauche ich in dem Zusammenhang kaum mehr zu erwähnen, so geläufig ist das Problem. „Möchtest du in Ruhe gelassen werden?“, fragte man mich. Nein, das war es nicht. Ich wollte gerne in Kontakt treten – aber in richtigen Kontakt. Zu oft bekam ich unnötige Updates, Bilder oder Nachrichten, die keinen Mehrwert brachten, sondern im Gegenteil Stress auslösten. Eine Flut an Infos, die letztendlich keine Infos waren. Um nicht falsch verstanden zu werden – es geht mir nie darum Kontakt zu reduzieren, sondern genau um das Gegenteil: Kontakte zu intensivieren und sie präsent und mit voller Aufmerksamkeit wahrzunehmen.
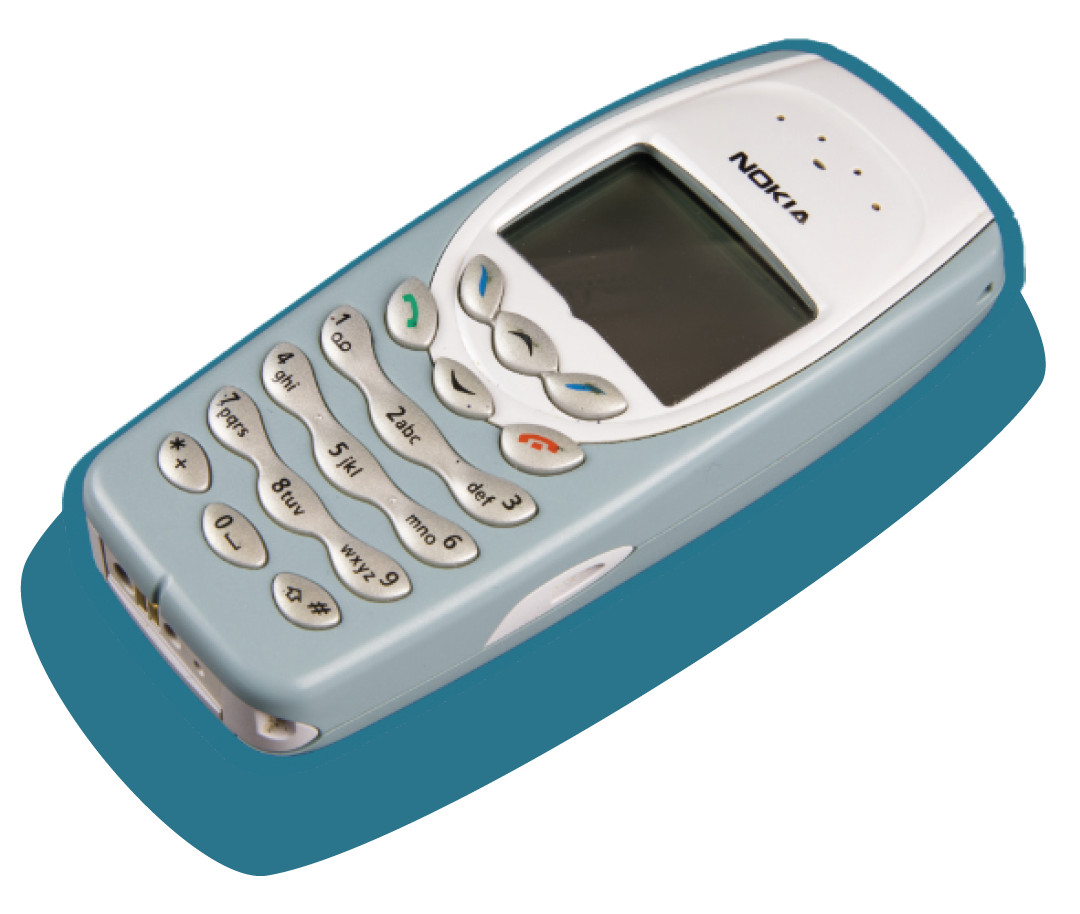
Das unkaputtbare Nokia-Handy
Kurz nachdem ich WhatsApp gelöscht hatte, stellte
sich tatsächlich eine gewisse Entspanntheit bei mir ein.
Ich griff nicht automatisch nach meinem Handy, denn
da gab es eh nichts zu sehen. Ein wundervoller Schritt
für mich, aber für meine Freund*innen und Familie
nicht so einfach. Es kamen trotzdem SMS rein,
Sprachnachrichten wurden über andere Kanäle geschickt
und nur wenige riefen an. Die Kommunikation
mit meinen Freund*innen stellte sich erst
langsam um, und natürlich hatte ich das Gefühl etwas
zu verpassen. Die Hürde mit mir Kontakt aufzunehmen
war nun größer geworden und nicht so
niedrigschwellig, wie eine schnelles „Na?“. Spontane
Verabredungen passierten weniger, und größere Unternehmungen
verlangten Planung im Voraus. Es wäre
falsch zu behaupten, der Verzicht auf WhatsApp hätte
mein Leben komplett vereinfacht, aber er entschleunigte
es definitiv.
Im letzten Monat meines Experiments bekam ich eine
so hohe Rechnung meines Mobilfunkanbieters, dass
ich mich den Umständlichkeiten beugte und den Messengerdienst
wieder installierte, statt mir einen neuen
Vertrag mit unlimitierten SMS und Minuten anzuschaffen.
Ich habe viele
Komplimente für die Löschaktion
bekommen, aber
angeschlossen hat sich keine*r.
Das sollte niemanden wundern.
Es hat sich nun mal
etabliert, dass sich der soziale
Kontakt auf WhatsApp oder einem
ähnlichen Messengerdienst
abspielt. Es scheint, als
bräuchten wir ein Smartphone,
um überhaupt in Kontakt zu treten – oder gar ein Sozialleben
zu führen?
Selbst in Gesellschaft ist es normal, ein Stück der
Aufmerksamkeit dem Handy zu schenken. Ich habe
meine Freund*innen dabei beobachtet (die sich der eigenen
Abhängigkeit ebenfalls bewusst sind). Eine
kleine Anekdote: Ich und eine Freundin machten Urlaub
in einem kleinen Trailer in Spanien. Wir hatten
leider ein paar Aufgaben zu erledigen, aber zum Glück
war WLAN vorhanden. Das gab allerdings am dritten
Tag den Geist auf. Für mich war das kein großes Problem,
denn ich hatte mein Handy sowieso fast die
ganze Zeit im Flugmodus und verhielt mich generell
recht analog (schrieb z. B. meine Hausarbeit auf Papier).
Aber für meine Freundin war das nicht so
einfach. Sie wollte Musik streamen und auf Instagram
sein. Zudem war an dem Morgen Twitter wegen eines
Dramas explodiert. Die Versuche, das WLAN wieder
in Gang zu setzen, scheiterten, also nuzte sie widerwillig
ihre mobilen Daten. Somit waren wir wieder online
und verfolgten die wichtigen Fragen des Lebens. Ich
ließ mich gerne mit hineinziehen, schließlich mussten
wir unbedingt wissen: DID HARRY STYLES SPIT
ON CHRIS PINE?
Die Strukturen unserer Gesellschaft
Das Problem lässt sich stufenweise angehen. Für manche
reicht es schon die Social Media-Apps zu
deinstallieren. Andere bräuchten noch mehr Abstand.
Die ständige Erreichbarkeit der Messengerdienste oder
der einfache Klick aus dem Arbeitsdokument raus lassen
zu viel Ablenkung zu und machen das Leben
stressiger als nötig. Dazu scheint es sogar Ideen und
Lösungsansätze zu geben: Um das Produktivitätsproblem
anzugehen, gibt es die Möglichkeit Webseiten,
Apps oder gleich das ganze Internet auf dem Handy
oder Computer zu blockieren.
Neulich las ich (im Internet), dass das große WWW
nicht als gut oder böse beschrieben werden könne. Es
sei ein Nutzgegenstand und somit
neutral. Einzig unser
Handeln werte es. Demnach
sind es wir selbst, die es zu
sinnvollen Zwecken nutzen
können, Illegales damit betreiben
oder unsere mentale Gesundheit zerstören.
Folglich liegt es am Verhalten der einzelnen Person.
„The Internet? Is that thing still around?“ – Homer Simpson
Auf den ersten Blick scheint die Lösung für den Umgang
mit Smartphone, Laptop und Co. die Balance zu
sein. In der Theorie klingt das wunderbar, aber in der
Praxis sind es dann doch eher die Extreme, an die wir
uns halten. Digital Detox ist zum Beispiel eine Möglichkeit,
um durch den Entzug von Social Media,
Netflix und anderen suchtauslösenden Interneterfahrungen,
sein Gehirn neu zu kalibrieren und
herunterzufahren. Es gibt viele Selbstexperimente, die
man auf YouTube (wie ironisch) verfolgen kann, von
Leuten, die eine Woche oder einen Monat auf Smartphone
und Co. verzichten. Und siehe da, alle sind
entspannter, leben mehr im Moment und genießen
ihre Zeit intensiver. Sobald die Experimentierzeit jedoch
abgelaufen ist, kehren sie zu ihren Geräten und
nach einiger Zeit zu ihren alten Gewohnheiten zurück.
Man kann es ihnen nicht verdenken, mir ist es ebenfalls
so ergangen.
Es liegt wohl doch an den Strukturen, die uns immer
wieder dazu zwingen, uns mit dem Internet zu verbinden.
Von da ist es nur ein kleiner Klick in die
unendlichen Weiten, raus aus der Realität und rein ins
Dopaminchaos. Es ist ein Teufelskreis, der jede*n zurück
in den Strudel der Information, des
Entertainments und der Arbeit zieht. Dabei selbst die
Kontrolle zu behalten, gelingt nicht vielen. I’m tired of
this, grandpa.
Well, that’s too damn bad. Das Internet abschaffen – von solchen Überzeugungen
halte ich mich fern. Es gibt zu viele positive Seiten.
Und auf die unendlichen Möglichkeiten der Technik
wollen wir auch nicht verzichten. In Deutschland werden
Stimmen laut, die das Land als schlechte
Internetnation kritisieren und hervorheben, wie weit
hinten die Bundesrepublik in Sachen Digitalisierung
liegt. Auch mir erschließt sich zum Beispiel die Notwendigkeit
Notwendigkeit von schnelleren, digitalisierten Abläufen in
Ämtern und Co. Ich rege mich schon auf, wenn man
irgendwo nicht mit Karte zahlen kann.
Aber unserem Umgang mit dem Internet Grenzen zu
setzen, ist meines Erachtens
trotzdem sinnvoll. Wir sollten
uns betrachten, als wären wir
undisziplinierte Kinder, die
des Schutzes bedürftig sind.
Und immer wieder reflektieren:
Ist unser Umgang mit dem Internet, den sozialen
Medien, den Streaming-Plattformen selbst gewählt
oder befinden wir uns in einer Abhängigkeit, die uns
durch den vom Internet durchzogenen Alltag gar
nicht aufgefallen ist?
Mein Essay endet mit einem Plädoyer für entschleunigtes
Leben und Arbeiten. Wir sollten Zeit haben, die
Gedanken fernab jeglicher Stimulierung wandern zu
lassen und uns auf die Stille einlassen zu können.
Wenn wir uns der Langeweile hingeben, überraschen
wir uns manchmal selbst. Haben wir den Mut unseren
Gedanken zuzuhören, stellen wir am Ende möglicherweise
fest, dass sich selbst kennenzulernen nicht so
furchtbar ist wie gedacht und es durchaus wert, nicht
sofort in Ablenkung zu flüchten.
Leider kann ich keine Komplettlösung für das Problem
anbieten. Falls jemand gute Ideen hat, lasst es
mich wissen und schreibt mir einen Brief.