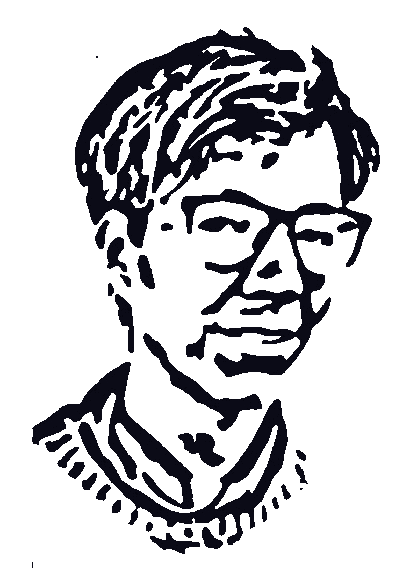Ideologie und Populärkultur. Mit diesen beiden Worten
wird Slavoj Žižek häufig in Verbindung gebracht.
Immer mal wieder taucht der Philosoph in der Filmwissenschaft
auf. Ausgangspunkt seiner Auseinandersetzungen
mit diesem Feld ist meist die Freilegung von
ideologischen filmischen Mitteln im Hollywoodkino.
Danach ist häufig die Rede von Freud, Lacan, dem
Phallus, dem Objekt klein a oder dem großen Anderen.
Žižek selbst wird oft mit ironischem Unterton rezipiert:
„Pure Ideology!“ ist eine Referenz, mit dem der
Vertreter der marxistisch orientierten Schule von
Ljubljana häufig im Meme-Zeitalter persifliert wird.
Und in den Kommentarspalten von Interviews, Vorträgen
und Ähnlichem scheinen die Leute eher damit
beschäftigt zu sein, wie häufig der neurotisch anmutende
Philosoph seine Nase berührt oder
Schniefgeräusche macht, als damit, sich mit den tatsächlichen
Inhalten zu befassen. Vielleicht liegt diese
Entwicklung aber auch ein wenig an Žižek selbst: Sein
Heranziehen von Beispielen, wie der Bauart von Toiletten
als Repräsentation ihrer jeweils länderspezifischen
Vergangenheit oder dem Kaffee ohne
Milch, der etwas ganz anderes ist als ein Kaffee ohne
Sahne, machen aus ihm einen ganz eigensinnigen Charakter.
Wie humoristisch dies auch dem Anschein
nach sein mag, sollte es nicht der einzige Grund sein,
sich mit seiner theoretischen Grundierung nochmals
genau zu befassen.
Gerade im Hinblick auf aktuelle Äußerungen Žižeks
ist eine kritische Relektüre seines Werks ratsam. Es sei
an dieser Stelle erwähnt, dass dieser Artikel verfasst
wurde, noch bevor sich Žižek bei der Eröffnungsrede
der Frankfurter Buchmesse 2023 kritisch über den aktuellen
Krieg zwischen Israel und Hamas geäußert hat.
Um möglichen Missverständnissen vorzubeugen, sei
hiermit darauf verwiesen, dass der Text sich nicht auf
jenes Ereignis bezieht.
Immer wieder begibt sich der „Elvis of Philosophy“ in
die Nähe von reaktionärem Gedankengut. Vor allem
in seinem im Februar 2023 im populistischen Magazin
Compact erschienenen Artikel „Wokeness is Here To
Stay“: Darin geht es um den juristischen Umgang mit
einem Sexualstrafakt einer Transfrau in Großbritannien
sowie um ein in den USA abgehaltenes Seminar
über Rassismus, welches eskalierte und zum Rauswurf
einiger Student*innen sowie dem Uniprofessor selbst
führte. Aus dem ersten Fall schließt Žižek strukturelle
Fallstricke der LGBTQIA* - Bewegung. Ausgangspunkt
ist ein Interessenskonflikt, der innerhalb der
schottischen Regierung zustande kam, als es um die
Frage ging, ob die Straftäterin in einem Männer- oder
Frauengefängnis unterzubringen sei. Grund genug für
Žižek, gemeinsam mit Verweis auf die in Großbritannien
zur Hormondämmung eingesetzten puberty
blockers einer „Trans Lobby“ von „another case of
woke capitalism“ zu sprechen. Im zweiten Fall dient
die Eskalation eines einzelnen Seminars als Beispiel für
eine derzeit fehlende Diskursfähigkeit, wenn es um
Fakten ginge. Anstelle der Wahrheit würden heutzutage
Gefühle im Mittelpunkt stehen, wodurch ein
neuer Dogmatismus entstehe: „this new cult combines
belief in fixed, objectivized dogmas with full trust in
how one feels (although only the oppressed blacks have
the right to refer to their feeling as the measure of the
racist’s guilt)“.
Es ist eine aus Strohmannargumenten zusammengesetzte
Polemik, die sich nur auf Feindseligkeit
gegenüber dem populistisch aufgeladenen Kampfbegriff
der wokeness zu stützen weiß, einem Begriff, der
längst von allen politischen Extrempositionen nach eigenem
Interesse umgedeutet wird. Unter den Tisch
fällt so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den
Themen, wodurch einmal mehr die ohnehin schon
prekäre gesellschaftliche Lage von Transpersonen und
BIPoC weiter aufrechterhalten wird. Bei alldem stellt
sich die Frage, wie es zu diesen Äußerungen kommt.
Liegt es an Žižeks Replik auf den deutschen Idealismus
und der Lacan’schen Psychoanalyse? Hat er sich dadurch
in eine Sackgasse begeben, die nun Gefahr läuft,
von reaktionären Neurechten beliebig angeeignet und
rekontextualisiert zu werden? Und was hat das alles
mit der Filmwissenschaft zu tun? Tatsächlich ist „Wokeness
is Here To Stay“ nicht Žižeks erste Polemik, die
von reaktionärer Kurzsichtigkeit durchdrungen ist.
Reflektiert man sein Schaffen, äußern sich argumentative
Lücken bereits weitaus früher. Aber der Reihe
nach. Will man sich Žižeks Theorie annähern, ist zunächst
ein kurzer Exkurs in seine philosophische
Tradition notwendig.
Exkurs: Hegel – Lacan – Žižek
Ein Einblick in sein erst vor wenigen Jahren auf
Deutsch erschienenes Frühwerk Das erhabene Objekt
der Ideologie legt bereits das theoretische Werkzeug
offen, auf das Žižek bis heute zurückgreift. Es ist die
Fusionierung der Begriffsdialektik Hegels mit der Psychoanalyse
Jacques Lacans, woraus Žižek einen eigenen
Ideologiebegriff entwirft. Entgegen der
panlogistischen Annahme, die in der Aufhebung die
erzwungene Unterwerfung aller Erscheinungen in
starre Begriffe versteht, richtet sich Žižeks Hegellektüre
allein auf ihre formalen Möglichkeiten. Die
Erwartungen, die mit einem Begriff verknüpft werden
können, ergeben sich demnach überhaupt erst dadurch,
dass die Erscheinungen in ihrer
Mannigfaltigkeit auf einen Begriff reduziert werden:
„Viel wichtiger ist, dass die signifizierende Reduktion
das innere Potential dieses Gegenstands akzentuiert
(ihm ein Profil verleiht).“ Der Fokus liegt somit auf
der Sprache, die nach Hegel als Allgemeines auf das
„Wahre der sinnlichen Gewissheit“ verweist.
Dadurch erschließt sich die Verbindung zu Lacan. Der
französische Psychoanalytiker ist durch seine strukturlogische
Relektüre Freuds bekannt. Beeinflusst durch
den Strukturalismus überträgt Lacan die zweite Topik
Freuds (Ich, Es, Über-Ich) in seine berühmte Triade:
Imaginäres, Symbolisches und Reales. So ist das Über-
Ich bei Lacan nicht mehr notwendigerweise das Produkt
der patriarchalen Position des Vaters, sondern als
Imperativ Teil des Symbolischen, was in jeder Form
der Sprache auf das Subjekt einwirken kann. Das Symbolische
als Sprache ist durch Signifikanten
strukturiert, die sich beispielsweise institutionell äußern.
Durch den Signifikanten „Studierende“ sind
diese zum Beispiel Teil des Universitätsdiskurses. Als
Garant der Sprache dient für Lacan der Terminus des
großen Anderen. Nur durch ihn wird die Artikulation
des Subjekts ermöglicht. Dabei existiert der große Andere
jedoch nicht wirklich in einer übersinnlichen
Sphäre, sondern wird durch das Subjekt erst selbst gesetzt.
Er dient also als dessen immanente
Selbstbegrenzung. So glauben „Studierende“ an den
großen Anderen, indem sie objektive Fakten voraussetzen,
um an Wissen zu gelangen. Hier zieht Žižek
wiederum die Verbindung zu Hegel, die sich insbesondere
durch dessen Kritik am kantianischen Dualismus
verstehen lässt. Während Kant das Ding an sich reflexionslogisch
als eine dem Subjekt äußerliche Welt
versteht, die unabhängig von dessen Sinnlichkeit persistiert,
vereint die Hegel’sche Dialektik das Für sich
mit dem An sich, da letzteres bereits von der subjektiven
Position bei Kant vorausgesetzt wird. Da diese
Voraussetzung nicht einfach so da ist, sondern vom
Menschen selbst gesetzt wird, kann man beide Sphären
(Ding an sich und Ding für sich) nach Hegel nicht
mehr voneinander trennen. Beides bedingt sich gegenseitig. Der große Andere ist daher instabil. Žižek
schreibt: „Wir begegnen hier den beiden gegensätzlichen
Aspekten des großen Anderen: Dem großen
Anderen als ‚Subjekt, das wissen soll‘, als Herr, der alles
sieht und insgeheim die Fäden zieht, und als Instanz
der reinen Erscheinung, als Instanz, die nicht wissen
soll, um derentwillen der Schein gewahrt werden
muss.“ Hier zeigt sich der Übergang zu Žižeks Ideologiebegriff.
Die Sprache erscheint als geschlossene
Totalität, indem sie ihre Lücken selbst kaschiert.
Wie aber lassen sich die Inkonsistenzen der Sprache
feststellen, wenn sie doch selbst die einzige Referenz
bei Lacan und Hegel ist? Die psychoanalytische Antwort
lautet: in den Symptomen. Man kann sich diese
als das Scheitern von Tätigkeiten vorstellen. Auf
sprachlicher Ebene beispielsweise durch bestimmte
Verkörperungen, die man im Alltag annimmt und die
es erlauben an der Gesellschaft zu partizipieren. Mitunter
scheitern solche Tätigkeiten, wenn zum Beispiel
ständig dieselben Fehler bei der Arbeit passieren oder
man sich nicht richtig ausdrücken kann. Der Untersuchung
solcher Phänomene auf individualpsychologischer
Ebene widmet sich die Psychoanalyse.
Dabei soll aus lacanianischer Sicht nicht der Mensch
an die Sprache angepasst werden (wie es Lacan an der
Entwicklung der amerikanischen Ich-Psychologie immer
wieder kritisierte), sondern umgekehrt: Der Ort
des großen Anderen soll vom Subjekt erkannt werden.
Wie aber gelangt Žižek von Lacans individualpsychologischer
Ebene zu seinem berühmt-berüchtigten
Ideologiebegriff? In seinem Buch Liebe dein Symptom
wie Dich selbst! plädiert Žižek für eine
Identifizierung mit dem Symptom. Dieses widersetzt
sich der symbolischen Ordnung und ist damit der einzige
Bezugspunkt, um deren Inkonsistenz zu erfassen.
Die universale Vorstellung eines Freiheitsbegriffs wird
demnach zum Beispiel in dem Moment subvertiert,
wenn es nach marxistischer Auffassung dazu kommt,
dass unter dem Decknamen der Freiheit die eigene Arbeitskraft
freien Marktmechanismen unterzuordnen
ist. Dieses Beispiel einer „symptomalen Ideologie“ ergänzt
Žižek um ihre phantasmatische Dimension.
Demnach behandelt man beispielsweise Geld so, als sei
es äquivalent zu einem Tauschwert, wenngleich man
weiß, dass Geld in seiner materiellen Beschaffenheit lediglich
aus Papier beziehungsweise Metall besteht.
Wissen allein bestimmt also nach Žižek nicht den
Grad, nach dem sich beurteilen lässt, ob man einer
Ideologie verfallen ist oder nicht. Vielmehr nimmt
man unbewusst teil an ideologischen Konstellationen.
Somit ist es auch nicht möglich, eine letztlich alles
überschauende objektive Haltung einzunehmen. Dies
klingt zunächst wie eine völlige Kapitulation vor jedweder
ideologischen Formation. Was hier aber
ausweglos erscheint, wird nach Žižek gerade zur Chance.
Aber wie von ihr Gebrauch machen?
Es sei nochmal auf den Begriff der Sprache verwiesen:
Da es nichts außerhalb von ihr gibt, dessen man sich
sicher sein kann, muss der Fokus auf der Sprache selbst
liegen. Als sprachlicher Code dienen nach Žižek demnach
auch Filme. So befragt er Bilder, Handlungen,
Akte, Montageverfahren etc. nach ihrer Funktion als
Teile einer (scheinbar) in sich geschlossenen Totalität.
So erhält der Eisberg in Titanic (US 1997) die Funktion,
die dem Kapitalismus inhärente Unmöglichkeit
der Liebe zwischen Rose (Kate Winslet) und Jack (Leonardo
DiCaprio) aufgrund ihres Klassenunterschieds
zu kaschieren, indem er als katastrophales Ereignis das
tragische Schicksal der Liebenden bestimmt. Die Vögel
in Hitchcocks gleichnamigen Film The Birds (Die
Vögel, US 1963) dienen nach Žižek als Verkörperung
des Lacan’schen Begriff des Realen: Als das, was nicht
symbolisiert werden kann, dringen sie in den sozial
durchsymbolisierten Raum ein. Ein Raum, in dem die
Mutter die Über-Ich-Funktion auf den Protagonisten
ausübt, da sie sich gegen dessen Heiratswunsch stellt.
Stets mit Replik auf Freud und Lacan’schem Vokabular
verweist Žižek in seinen Büchern auf viele weitere
Filme. So auch auf die erwähnenswerten Dokus
The Pervert's Guide to Cinema (UK/NL/AU 2006)
und The Pervert's Guide to Ideology (UK
2011) von Sophie Fiennes.
Verbleibt Žižeks Filmverständnis aber lediglich auf
dem Verweis ideologischer Konstellationen? Was er
mit dem Unsymbolisierbaren meint, erlangt an Ambivalenz,
wenn man einen genauen Blick auf seine
Untersuchung von Filmszenen wirft. Eine Filmszene
zeigt nicht einfach alles, sondern schließt auch bestimmte
Dinge aus. Die sogenannte Nahtstelle –
Lacans point de caption, zu Deutsch: Stepppunkt –
vernäht diese Kluft. Als „blinder Fleck im Feld des
Sichtbaren“ äußert sich ein dritter Blick in den Objekten
selbst. Eine solche dritte Perspektive als Platzhalter
einer vollkommenen Totalität, macht diese in ihrer
Funktion und folglich ihre Inkonsistenz erst sichtbar.
Alfred Hitchcock gilt für Žižek als der Regisseur, der
diesem fehlenden Blick Rechnung trägt: In Psycho
(US 1960) betritt der Privatdetektiv Arbogas (Martin
Balsam) das Haus von Norman Bates (Anthony Perkins).
Aus der Vogelperspektive sieht man, wie er vom
Treppenhaus in das Zimmer von Bates Mutter gelangt.
Ohne die Mutter selbst zu sehen, wird er erstochen
und stolpert rückwärts die Treppe hinab. Nach dem
Filmwissenschaftler Lucas Curstädt wäre nun die neoformalistische
Lesart eines David Bordwells die
folgende: Als Zuschauende sollen wir davon abgehalten
werden, den als seine Mutter verkleideten Norman
Bates zu erblicken, da ja so der Twist des Films vorweggenommen
würde. Erklärt wird dadurch aber nicht
die Wahl der ungewöhnlichen Perspektive, aus welcher
der verletzte, wankende Arbogas rückwärts die Treppe
hinabstolpert. Diese Einstellung kann daher keiner
Person in der Szene zugeordnet werden. Um ihre
Funktion überhaupt erfassen zu können, benötigt sie
deshalb eine Einhegung innerhalb des diegetischen
Raums. Das Hegel’sche Diktum einer sich nie festlegenden
Oszillation zwischen Subjekt und Objekt tritt
hier wieder in Erscheinung. Das symbolische Konstrukt
öffnet sich. Hitchcock lässt die Naht reißen, mit
all ihren Konsequenzen. Žižek schreibt in seinem Werk
Die Furcht vor echten Tränen dazu folgendes: „Erstens
erzeugt schon der charakteristische
Hitchcocksche Wechsel zwischen dem Ding und dem
point-of-View-Shot dieses Dings nicht die als ‚Naht‘
fungierende Wirkung, sondern die Spannung bleibt
unaufgelöst. Und zweitens hat es den Anschein, als
werde diese Spannung plötzlich freigesetzt und entlade
sich zugleich, indem sie zu einer höheren Potenz erhoben,
d. h. indem sie beschleunigt und in eine andere
wesentlich radikalere Dualität verwandelt wird: der
Wechsel von der objektiven Aufnahme aus der ‚Sicht
Gottes‘ zur unheimlichen Subjektivierung.“ Žižeks
Filmtheorie ist also keine Quadratur des Kreises. Das
Scheitern der symbolischen Ordnung, sobald ein dritter
Blick als ergänzendes Schlüsselmoment gesetzt
wird, bedeutet nicht zwangsweise das Erkennen einer
ideologischen Funktion, sondern kann, wie bei Hitchcock,
auch den Horror der Unsymbolisierbarkeit
anzeigen. Es ist daher nicht einfach alles Ideologie,
auch wenn Žižek häufig darauf reduziert wird.
Im dialektischen Würgegriff
Die Offenheit gegenüber dem Unsymbolisierbaren,
die Žižek bei seinen Filmbeispielen an den Tag legt,
tritt zurück, wenn er sich auf Politik und Gesellschaft
bezieht. An dieser Stelle sei sein Bezug zu Hegel kurz
erläutert: Laut Žižek wird der Zufall (Kontingenz)
nicht einfach von der Synthese unterlaufen, vielmehr
werde die Unmöglichkeit seiner begrifflichen Zuordnung
in der Hegel’schen Synthese mit einkalkuliert.
Ein zufälliges Ereignis geht demnach nicht einfach in
einem teleologischen Zusammenhang von Ursache
und Wirkung auf, sondern stattdessen wird eben jene
Struktur hinterfragt. Die daher nachträgliche Bedeutungszuweisung
einer Erscheinung durch die Sprache
zeigt als „retroaktive Performativität“ in bündigster
Form die dialektische Methode an, mit der Žižek arbeitet.
Sein Anliegen ist motiviert durch die
Hinterfragung der Bedingungen, die eine Notwendigkeit
konstruieren.
Die wohl ausführlichste Anwendung dieser dialektischen
Festnahmetechnik zeigt sich in seinem Werk
Weniger als nichts. In dieser über 1300 Seiten schweren
Trainingseinlage reflexionslogischen Denkens
schlägt sich Žižek querbeet durch die westliche Philosophiegeschichte.
Angefangen bei den Dialogen des
Parmenides, über Paulus als Verkünder des Badiou’
schen Wahrheitsereignisses, Fichte als Versuch Kants
Ding an Sich zu überwinden, Heideggers Seinsbegriff,
Derridas Dekonstruktion und Butlers Genderperformativität
bis hin zu den Neomaterialismen und der
Quantenphysik. Nichts entgeht der radikalen Prüfung
des hegelianischen Spagats zwischen Kontingenz und
Notwendigkeit mit Lacan’schem Vokabular. Und hier
deuten sich bereits die Probleme an. Žižek versteht seine
dialektische Methode als Allzweckmethode, die
genau dann problematisch wird, sobald er Totalitäten
voraussetzt, die er selbst erst konstruiert, um ihre inhärenten
Lücken dann nach eigenem Ermessen
auszufüllen. Ein Beispiel: Der Zwischenraum einer abgelegten
Prüfung und der Notenvergabe wird für
Žižek von einer Lücke zwischen dem Konstativen und
Performativen bestimmt. Auch wenn man sich sicher
sein kann, die Prüfung bestanden zu haben, ist man
auf die Verifizierung des Systems angewiesen. Diese
muss sich auf eine „Antwort des Realen“ stützen. Das
Beispiel des Verliebtseins, das Žižek mit dem Satz „to
fall in love“ veranschaulicht, lässt sich hier anführen:
„Sie [die Liebe; SW] muss ein Element der ‚Antwort
des Realen‘ enthalten (‚wir waren schon immer füreinander
bestimmt‘), ich kann nicht hinnehmen, dass ich
mich aus reinem Zufall verliebt haben soll“. Nun richtet
er dieses Argument zugleich auch gegen
Transpersonen, die behaupten, nun endlich den Körper
beziehungsweise die Identität zu haben, die sie von
Geburt an wollten. Žižek zufolge würde ein solcher
Standpunkt den eigentlichen Akt des Übergangmoments
der geschlechtlichen Neuorientierung
verfehlen. Nach Definition der retroaktiven Performativität
würde hier also das kontingente Ereignis der
Genderdysphorie nicht als solches anerkannt. Žižek
sieht darin einen essentialistischen Glaubenssatz, der
der Vorstellung an feste angeborene Identitäten verhaftet
bliebe. Dabei verheddert er sich in seinen
eigenen dialektischen Fallstricken. Es ist ja gerade diese
performative Setzung, die eine solche Identität überhaupt
erst ermöglicht. Und wie oben erwähnt,
funktioniert die symbolische Ordnung ja erst durch
eine Geste des so tun als ob. Folgt man nun der Lacan’
schen Terminologie weiter, würde man Transpersonen
vorwerfen, ganz und gar psychotisch zu sein. Die Psychose
ist nach Lacan die Verwerfung mit dem großen
Anderen. Der Garant der Sprache funktioniert demnach
nicht mehr. Das Subjekt stünde außerhalb der
symbolischen Ordnung und seine inhärente Selbstbegrenzung
als gespaltenes Subjekt löse sich auf. Aus
kantianischer Sicht könnte man sagen, das Subjekt
werde deckungsgleich mit dem Ding an sich. Die Sprache
als Bezugnahme und Begründung von Identität
und Begehren fällt in sich zusammen.
Žižek sieht demnach Transpersonen als essentialistisch
denkende, ihre eigene Position verkennende Individuen.
Dies würde bedeuten, dass sprachlich festgelegte
Identitäten deckungsgleich seien mit der Natur. Es ist
verwunderlich, dass Žižek sich der Konsequenz dieser
Folgerung nicht bewusst ist. Die Vermutung liegt jedoch
nahe, dass dieses Argument Zeugnis ablegt einer
bestimmten Haltung gegenüber der LGBTQIA*-Bewegung.
Er wirft ihr an anderer Stelle vor, nicht
inhärent revolutionär zu sein, da sie nichts an spätkapitalistischen
Gesellschaften ändern würde. Bei allem
Respekt vor jeder berechtigten Kritik am Kapitalismus
sollte man sich eingestehen, dass Žižeks Intention von
Letztbegründungen auf einen abstrakten Begriff Gefahr
läuft, in ihr Gegenteil umzuschlagen. Dass sich
Neurechte diese Strategie längst angeeignet haben,
scheint ihn nicht zu interessieren. Sobald er sich also in
„Wokeness is Here to Stay“ auf die Seite der „Anti-Woken“
schlägt, untergräbt er damit die eigene Theorie.
Seine eigene(!) Interpretation des Films Matrix (US/
AU 1999) lässt sich hier anführen. Diesen versteht er
als einen Film, der „eine zweite ‚reale‘ Realität hinter
der von der Matrix gestützten Alltagsrealität“ setzt.
Die Entscheidung für die rote Pille erzeugt demnach
keinen tatsächlich objektiven Blick auf eine wirkliche
Welt. Daher ist es kaum verwunderlich, dass sich
User*innen der US-amerikanischen Alt-Right-Bewegung
in Reddit-Foren den Begriff der Red-Piller
angeeignet haben und sich als „schonungslose Realist*
innen“ betrachten. An dieser Stelle wird Žižek
Opfer seines eigenen Ideologiebegriffs: Er weiß, was er
tut, aber er tut es trotzdem.
Žižek vs. Žižek
Genauso wenig wie Hegel ist auch ein Lacan nicht einfach
Ideologiekritiker. So gerät Žižek ebenso in ein
Missverhältnis zu seinen theoretischen Vorbildern,
wenn er sich in einem Beitrag mit dem sperrigen und
dennoch vielsagenden Titel „Soll denn nun auch alles
Erotische entzaubert werden? In was für langweiligen
Zeiten leben wir eigentlich?“ gegen die Ausstellung
von nicht-pornografischen Fotografien weiblicher
Geschlechtsorgane positioniert. Seine daraufhin heraufbeschworene
Dystopie definiert er als „graue
Realität, in der Sex vollkommen unterdrückt wird“.
Sein Verweis auf die „Würde des Dings“ bei Lacan sollte
hier jedoch nicht zu dem Fehlschluss führen,
Lacan’sche Theorie würde sich ebenso klar verschließen
gegenüber einer Darstellung der Vulva, die ohne
misogyne Perspektive auskommt. Führen wir Žižeks
Gedankengang einmal weiter aus, offenbart sich, dass
er hier eher einem – nach der Psychoanalytikerin Joan
Copjec – panoptischen Blick á la Foucault verhaftet
bleibt, der dem Lacan’schen Blick diametral entgegensteht.
Ersterer gestattet die völlige Transparenz auf den
eigenen Körper, wonach das Bild rein repräsentativ
bleibt. Letzterer trägt dem Reflexionsbewusstsein des
Subjekts Rechnung. Seien es nun verbildlichte Geschlechtsorgane
oder andere Körperteile, in allen
Fällen ist nach Lacan nicht einfach das Subjekt diesen
Bildern rein unterworfen, sondern tritt auch hier im
Rahmen der medialen Vermittlung dem großen Anderen
gegenüber.
Die eigentliche Stärke in Žižeks Theoriegebäude liegt
schlussendlich darin, totalitäre Strukturen unter gegebenen
sprachlichen Codes aufzubrechen. Unter
Rückgriff auf Lacan und der Begriffsdialektik Hegels
gelingt es ihm, nach den Lücken Ausschau zu halten,
die von Bedingungen für eine Notwendigkeit kaschiert
werden. Der Fokus liegt dabei auf der
sprachlichen Ebene, ohne dass ein objektiver Blick von
außen kritiklos vorausgesetzt wird. Seine Theorie
schwächelt allerdings genau dann, wenn er paradoxerweise
dazu neigt, die immanente unauflösbare Kluft
nicht als solche anzuerkennen, sondern sie selbst wieder
„vernäht“ und die symbolische Totalität dadurch
aufrechterhält. Dies zeigt sich vermehrt in seiner Hinwendung
zur anti-woken Bewegung. Seine Ablehnung
des „Multikulturalismus“ ist jedoch nichts Neues. So
äußerte er sich schon in den 90er Jahren in seinem
Buch Die Tücke des Subjekts kritisch zu den Cultural
Studies: „Der eigentliche politische Kampf wird zum
Kulturkampf um die Anerkennung marginaler Identitäten
und die Toleranz gegenüber Unterschieden.“
Solche Formulierungen bieten nicht notwendigerweise,
aber zumindest potentiell, das Fundament für
neokonservative Aneignungen. Dieser in seiner Kritik
Rechnung zu tragen, vermag Žižek nicht zu leisten.
Mit seinen philosophischen Wurzeln hat das allerdings
nichts zu tun.
In diesem Sinne bleibt ein dialektisch ausgeklügeltes
Begriffswerkzeug, das man ab jetzt vielleicht eher selbst
in die Hand nehmen sollte. Žižek wirft Hegel immer
mal wieder vor, nicht hegelianisch genug gewesen zu
sein, wenn er den Pöbel nicht als das verdrängte Moment
der gesellschaftlichen Ordnung begriffen hat,
was Marx hingegen in der Position des Proletariers innerhalb
der kapitalistischen Ordnung erkannt habe.
Vielleicht sollte man an dieser Stelle auch Žižek vorwerfen,
nicht zizekianisch genug zu sein, wenn er die
unaufhebbare Lücke innerhalb der symbolischen Ordnung
frühzeitig zu verschließen gewillt ist. Wir können
noch immer wählen zwischen Backlash und Pluralität.
Der Wahrheitsanspruch der Sprache erfordert immer
einer nachträglichen Prüfung, um sich seiner zeitlichstrukturellen
Abhängigkeit bewusst zu werden. So
wusste Hegel doch genau: „Die Eule der Minerva beginnt
erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren
Flug.“
QUELLEN
- Curstädt, Lucas (2020): Slavoj Žižek und das Kino 3/3 | Essay #12. (23.12.2023).
- Žižek, Slavoj (2021): Soll denn nun auch alles Erotische entzaubert werden? In was für langweiligen Zeiten leben wir eigentlich? (22.08.2023).
- Žižek, Slavoj (2023): Wokeness Is Here To Stay. (22.08.2023).
- Copjec, Joan (2004): Lies mein Begehren – Lacan gegen die Historisten. München: P. Kirchheim [eng. 1994].
- Žižek, Slavoj (1991): Liebe dein Symptom wie dich selbst! Berlin: Merve Verlag.
- Žižek, Slavoj (2001): Die Furcht vor echten Tränen: Krysztof Kieslowski und die „Nahtstelle“ Berlin: Volk und Welt.
- Žižek, Slavoj (2010): Die Tücke des Subjekts. Berlin: Suhrkamp Verlag [engl. 1999].
- Žižek, Slavoj (2020): Weniger als nichts – Hegel und der Schatten des dialektischen Materialismus. Berlin: Suhrkamp Verlag [engl. 2012].
- Žižek, Slavoj (2021): Das erhabene Objekt der Ideologie. Wien: Passagen Verlag [engl. 1989].